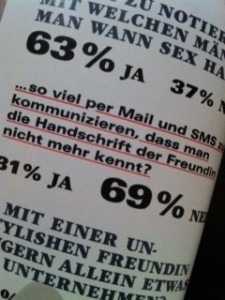Dies ist eine Geschichte von Schafen und Schäfern. Eigentlich aber auch ein bisschen von Kaninchen. Versuchskaninchen. Könnte man jedenfalls so sagen, nachdem Gabi, angeregt durch Reinhard Bauer, auf die Idee kam, eine Schreibwerkstatt im Kolloquium durchzuführen. Das genaue Konzept kann hier nachgelesen werden. Laut Zeitplan war ich die Erste, die dieses Experiment mitmachen durfte. Ich habe mich dazu entschieden, diesen Blogbeitrag prozessbegleitend zu schreiben – im Moment (17.09.10) ist es also nur ein Entwurf, der dann nach der Durchführung der Schreibwerkstatt mit allen Erfahrungen veröffentlicht wird.
Aber jetzt mal zum Schaf-Thema: Die Teilnehmer des Kolloquiums (a.k.a. Schafe) waren aufgefordert, sich einen Schäfer zu suchen, der sich bereit erklärt, einen Text zu reviewen. Das Ganze passiert in zwei Schlaufen bevor dann alle Doktoranden den verbesserten Text zur Vorbereitung geschickt bekommen. In der Präsenzsitzung wird dann darüber diskutiert.
Phase 1: Schäfer – Schaf
Ich habe mir Freddy als Schäfer ausgesucht. Zum einen, weil er mein selbsternannter Diss-Tandempartner ist (was ein guter Deal für mich ist, weil er seine Promotion schon lange abgeschlossen hat 🙂 ) und zum anderen, weil ich von ihm sehr gut Kritik annehmen kann: Er kann verständlich erklären, wo er Verbesserungspotenzial sieht und als alter Hase weiß er auch, worauf zu achten ist. Mir scheint, für ihn war das eine genauso große Herausforderung, wie für mich. Nachdem ich ihn gebeten hatte, SUPER kritisch zu sein, hat er auch wirklich zu jedem Satz der zehn Seiten eine Anmerkung gemacht. Das war für ihn viel Arbeit und für mich dann auch, als ich die Anregungen integriert habe. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Bereits nach Runde 1 finde ich den Text viel besser und runder als vorher! Auch die empfohlene zweite Feedback-Runde läuft ziemlich problemlos. Ich bekomme noch gesagt, was denn alles gut sei am Text *freu* und noch ein paar kleine Anmerkungen, die ich auch als sinnvoll erachte und deshalb einbaue.
Phase 2 – Versenden und Lesen:
Es geht in Phase 2 des Experiments. Jetzt müssen alle Workshopteilnehmer meinen Beitrag lesen, auch ich bekomme die Beiträge der anderen zwei Schäfchen zum intensiven Lesen. Dadurch, dass ich weiß, wie viel Arbeit bereits im Artikel steckt, lese ich die Texte noch aufmerksamer als sonst und mache mir Notizen für den Workshop. Die zwei Texte, die ich reviewen muss, sind sehr unterschiedlich: beim einen geht es um ein Dissertationsvorhaben, beim anderen um ein fertiges Kapitel einer Promotionsarbeit.
Phase 3 – Präsenzsitzung:
Es folgte das Kolloquium, in dem die Texte besprochen wurden. Ich hatte die Ehre, als Erste anzutreten. Nachdem ich kurz in den Text eingeführt hatte und einige kleinere Fragen zum Kontext und Inhalt geklärt waren, musste ich die Runde verlassen und mich von den anderen abwenden. Das Ganze soll bezwecken, dass die nun folgende Diskussion sich nicht auf mich als Person konzentriert, sondern auf der Sachebene am Text orientiert ist. Ich hatte mir die Situation sehr seltsam vorgestellt, aber wider Erwarten war das echt ein gutes Erlebnis! Oft sagt man ja „da wäre ich gerne Mäuschen gewesen“: zu hören, wie die anderen meinen Text beurteilen, konstruktive Vorschläge machen und über einzelne Passagen diskutieren – spannend! Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt angegriffen oder „ungerecht“ behandelt gefühlt. Zwar musste ich wohl gelegentlich lachen oder den Kopf schütteln, weil ich da erst gemerkt habe, dass das, was ich im Text ausdrücken will, noch nicht präzise genug argumentiere – aber auf persönlicher Ebene war das ziemlich relaxed. Irgendwann durfte ich den Kreis dann wieder betreten und noch letzte Fragen klären. Ganz offiziell wird dann nochmal gedankt, dass man den Text mit den anderen geteilt hat. Aber auch ich will mich bedanken, weil ich gemerkt habe, dass die anderen Teilnehmer sich wirklich intensiv mit dem Text auseinandergesetzt haben und Sachen aufgekommen sind, die ich einfach gar nicht mehr gesehen habe. Die Sitzung war fordernd aber mir hat das wirklich was gebracht. Ich kann deshalb Leuten, die (wissenschaftlich) schreiben, nur dazu raten, so etwas auch mal zu organisieren und durchzuführen. Wenn man sich darauf einlässt, hat man einen großen Nutzen davon. Gabi hat auch schon gebloggt – hier gibt es den Beitrag zum Nachlesen.
Für mich geht es jetzt noch darum, die Anmerkungen noch zu überdenken und dann in den Text einzubauen. Ein Teilnehmer hat mich nach dem Kolloquium gefragt, „ob ich denn jetzt noch was ändern werde“. Ja klar! Die Ideen waren teilweise wirklich sinnvoll und total nachvollziehbar. Es wäre ja Irrsinn, das zu ignorieren…